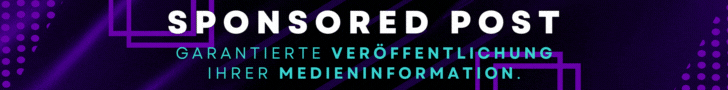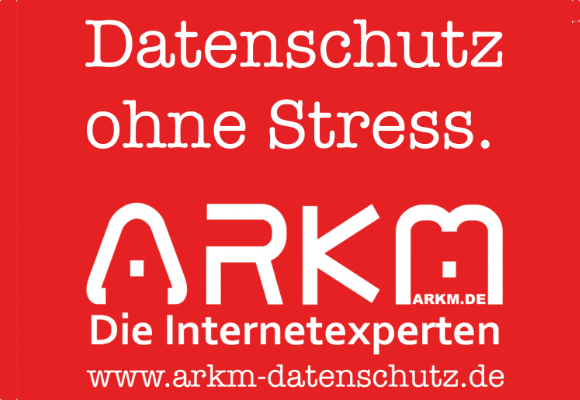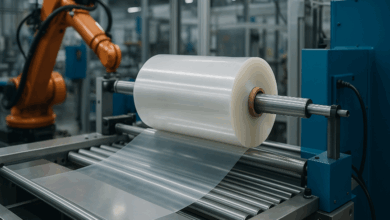Digitalisierungshürden für Unternehmer
Die Digitalisierung verspricht effizientere Prozesse, einen schnelleren Austausch und neue Geschäftsmöglichkeiten. Für viele Unternehmer aus dem Mittelstand fühlt sich der Weg dorthin allerdings eher wie ein Hindernislauf an. Besonders in kleinen und mittleren Betrieben zeigt sich häufig, dass technische Lösungen allein nicht ausreichen, denn organisatorische, personelle und strukturelle Fragen bremsen den Fortschritt ebenfalls. Für Unternehmen kommt es also darauf an, digitale Tools einzusetzen und zugleich typische Hürden im Tagesgeschäft gezielt anzugehen.
Wenn Verwaltungsprozesse ausbremsen
In vielen Fällen beginnt die Digitalisierung im eigenen Büro, unter anderem mit Anträgen, Genehmigungen und Formularen von Behörden. Zwar gibt es gesetzliche Vorgaben, um Verwaltungsvorgänge online bereitzustellen, aber die Umsetzung geschieht uneinheitlich. Unternehmer sehen sich darum immer noch mit Faxformularen, fehlenden Schnittstellen und unterschiedlichen Landesportalen konfrontiert. Sind verschiedene Stellen eingebunden, verlängert sich die Bearbeitungszeit zudem erheblich.
Der Wechsel zwischen digitalen Systemen und Papierformularen kostet ebenfalls Zeit und führt meist zu unnötigem Mehraufwand. Die Idee, Informationen einmal anzugeben und dann mehrfach zu nutzen, steckt vielerorts noch in den Kinderschuhen.
Elektronische Rechnungen werden Pflicht
Seit dem 1. Januar 2025 sind Unternehmen in Deutschland verpflichtet, elektronische Rechnungen im B2B-Bereich zu empfangen. Für viele Betriebe ist das der Einstieg in eine neue Pflicht zur digitalen Abwicklung. Auch wenn einige kleine Unternehmen noch Ausnahmeklauseln bei der Umstellung auf elektronische Rechnungen nutzen dürfen, ist es von Vorteil, den Wechsel von klassischen PDF- oder Papierrechnungen nicht zu verzögern
Für kleine Unternehmen stellt sich dabei insbesondere die technische Frage, aber auch Organisatorisches ist zu klären. Wie lässt sich schließlich das eigene Rechnungswesen so anpassen, dass der Aufwand nicht ausufert? Kleinunternehmen, die sich frühzeitig umstellen, vereinfachen Prozesse, minimieren Fehlerquellen und bereiten sich zugleich bestmöglich auf kommende Anforderungen vor. Die Digitalisierung im Büro durch E-Rechnungen erleichtert den Arbeitsalltag obendrein mit automatisierten Abläufen, schnellerer Dokumentenverwaltung und einem verbesserten Informationsfluss zwischen den Abteilungen. Dadurch reduzieren sich manuelle Fehler, der Zeitaufwand für Routineaufgaben sinkt deutlich und die Zusammenarbeit im Team wird effizienter.
Was Unternehmer selbst anstoßen sollten
Viele Unternehmen unterschätzen, wie viel sich bereits mit kleinen Maßnahmen erreichen lässt. Digitale Rechnungen statt Kassenzettel, Online-Buchungssysteme statt handschriftlicher Terminlisten oder cloudbasierte Tools für Projektarbeit sind längst verfügbar und oft auch bezahlbar. Der Einstieg beginnt mit einer Bestandsaufnahme.
- Welche Abläufe laufen noch manuell?
- Wo gehen Informationen verloren oder verzögern sich Entscheidungen?
- Welche digitalen Lösungen könnten Routineaufgaben vereinfachen und Mitarbeiter entlasten?
Fragen dieser Art im eigenen Betrieb helfen dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen digitale Werkzeuge spürbare Vorteile bringen. Auch im Einzelhandel, in der Gastronomie oder im Handwerk lassen sich Prozesse digitalisieren, sei es durch automatisierte Lagerverwaltung, cloudbasierte Buchhaltung oder digitale Zeiterfassung für Mitarbeitende. Ausschlaggebend ist in jedem Fall, Veränderungen Schritt für Schritt umzusetzen und die Belegschaft einzubeziehen.
Mitarbeiterqualifizierung als Erfolgsgarant
Eine neue Software einzuführen, reicht nicht aus, denn die Mitarbeiter sollten sie auch verstehen und konsequent nutzen. Viele Unternehmen berichten jedoch, dass vorhandene Tools nur unvollständig zum Einsatz kommen, aufgrund von Unsicherheit oder fehlender Schulung. Deshalb ist es sinnvoll, gezielt in Weiterbildung zu investieren. Kurze Trainings, regelmäßige Systemschulungen und feste Ansprechpartner im Unternehmen erleichtern letztlich den Umgang mit neuen Technologien und auch Kooperationen mit spezialisierten Dienstleistern schließen potenzielle Lücken.
Nachholbedarfe bei behördlicher Digitalisierung
Obwohl Unternehmen zunehmend bereit sind, eigene Prozesse zu modernisieren, bleibt die digitale Infrastruktur der öffentlichen Hand ein Problem. Die Anbindung an Online-Portale funktioniert zum Beispiel nicht durchgehend stabil und viele Verwaltungsverfahren lassen sich nur auf Umwegen digital abwickeln. Geplante Lösungen, darunter ein einheitliches Unternehmenskonto oder digitale Registerabgleiche, sind zwar angekündigt, aber in der Praxis nur punktuell verfügbar.
Speziell für kleinere Betriebe bedeutet das doppelte Arbeit, viele Rückfragen und unklare Abläufe. Hier braucht es neben einer besseren Software also auch einen grundlegenden Kulturwandel in der Verwaltung.
Schritte zu mehr Digitalisierung im Alltag
Digitaler Wandel erfordert Mut zur Veränderung, aber kein blindes Tempo. Denn nur wenn Unternehmen Schritt für Schritt vorgehen, Prozesse kritisch hinterfragen und Mitarbeiter einbinden, legen sie eine stabile Grundlage. Viele Förderprogramme, zum Beispiel auf Landesebene oder über Wirtschaftskammern, bieten übrigens Unterstützung bei der Einführung neuer Technologien.
Auch der Austausch mit anderen Unternehmen aus der Region oder der eigenen Branche bringt neue Impulse. Häufig sind es nicht die großen Leuchtturmprojekte, vielmehr praktische Alltagslösungen, die echte Wirkung zeigen. Digitalisierung wird schließlich nicht von einer Stelle ausgehend gesteuert; sie entsteht im Alltag, getragen von konsequenten Entscheidungen und klaren Verantwortlichkeiten.